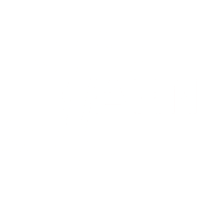Politisch sein: ja! – einseitig Politik machen: Nein!
Fortsetzung der Diskussionsreihe zu aktuellen politischen Kontroversen an der Otto-Hahn-Schule.
Am Freitag, dem 23. Juni 2017, diskutierte der Journalist und Buchautor Constantin Schreiber gemeinsam mit Walter Rothschild (Rabbiner), Bernd Albani (evangelischer Pfarrer) und Ender Cetin (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Sehitlik-Moschee) zur Frage, ob in Gotteshäusern Politik gepredigt werden darf.
Anlass der Diskussionsveranstaltung war die von Schreiber verfasste Reportage „Inside Islam. Was in deutschen Moscheen gepredigt wird.“ Schreiber hatte 13 Moscheen, davon 8 in Berlin, besucht und die Predigten angehört, übersetzen und deren Inhalt von Islamwissenschaftlern bewerten lassen.
Eingangs erläuterte der Journalist, er habe den Spekulationen, über das, was in Deutschlands Moscheen gepredigt werde, mit konkreten Beobachtungen entgegentreten wollen. Ender Cetin kritisierte, dass der Titel des Buches dann „Inside Deutschlands Moscheen“ heißen müsste und nicht suggerieren dürfe eine Innensicht des Islams zu geben.
Die Diskussionsveranstaltung sollte jedoch nicht ausschließlich Moscheen in den Blick nehmen, sondern den SchülerInnen auch einen Blick auf die beiden anderen montheiistischen Weltreligionen ermöglichen: „Inside Religion – darf in Gotteshäusern Politik gepredigt werden?“
Die Vertreter der drei großen monotheistischen Religionen antworteten sehr ähnlich: Ihre Predigten seien zwangsläufig politisch, da sie sich um das Zusammenleben in einer Gemeinschaft und deren Regeln drehten. Allerdings dürfe dies nicht als (partei-) politische Einflussnahme geschehen.
Schreiber zog eine ernüchternde Bilanz: In den untersuchten Predigten habe ein Bekenntnis zur Integration in Deutschland gefehlt. Kaum erkennbar sei eine Trennung zwischen Politik und Religion gewesen, doch schlimmer noch: in einem Fall sei Jesiden und anderen nichtmuslimischen Gruppen die Gleichwertigkeit abgesprochen worden.
Auf die Frage, wie unabhängig sie in ihren Predigten seien, antwortete Herr Albani, dass er alles predigen könnte, solange es nicht dem Grundgesetz und der christlichen Lehre widerspreche. Auch Werbung für Parteien sei ausgeschlossen. Das Bibelzitat werde zentral vorgegeben, die inhaltliche Ausgestaltung und Interpretation bleibe dem Pfarrer überlassen.
Dies sei, so Ender Cetin, in den (Ditib-) Moscheen anders: Hier werde die „Hauptpredigt“ vorgegeben, der Imam könne zu Beginn jedoch eigene Positionen und Textstellen einfließen lassen.
Rabbi Rothschild merkte an, dass es in jeder der drei Religionen sehr konservative und sehr moderne Auslegungen gebe, worauf Herr Albani ergänzte, dass er den Eindruck habe, dass die modernen Muslime eher eine Randerscheinung mit geringem Einfluss seien.
Als Herr Rothschild von einem großen Elefanten im Raum sprach, war die Verwunderung zunächst groß: Er meinte damit eine Frage, die bisher niemand thematisieren wollte: Woher kommt der Judenhass in Teilen der muslimischen Community?
Ender Cetin verwies daraufhin auf die Salaam-Schalom-Initiative aus Neukölln.
https://de.wikipedia.org/wiki/Salaam-Schalom_Initiative
http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/18325
http://www.buendnis-toleranz.de/themen/antisemitismus/168678/die-salaam-schalom-initiative-fuer-ein-friedliches-zusammenleben-in-neukoelln-und-darueber-hinaus
Darüber, dass es sehr negativ Einfluss nehmende Imame gebe, war man sich in der Runde einig. Einigkeit bei allen Diskussionsteilnehmern bestand daher in dem Wunsch und der Forderung nach in Deutschland ausgebildeten Imamen. Ender Cetin sagte jedoch zur Verwunderung einiger Anwesender auch, dass sich manche Imame aus dem Ausland an die Wünsche nach konservativen Predigten ihrer Gemeinden in Deutschland anpassen müssten.
Constantin Schreiber stellte heraus, dass 12 seiner 13 besuchten Predigten als problematisch eingestuft wurden. Daraufhin wurde aus den Reihen der Schüler wiederholt Kritik an den Übersetzungen geübt, größtenteils jedoch ohne das Buch überhaupt vollständig gelesen zu haben.
Weiterhin verwies Schreiber auf die Tatsache, dass 11 von 13 Moscheen die professionellen Übersetzungen nicht angezweifelt, die anderen beiden vor Gericht aufgrund der Tonaufnahmen verloren hätten. Er räumte ebenfalls ein, dass seine Untersuchung nicht repräsentativ sein könne, er aber natürlich das Gehörte nicht zum Gefallen der Zuhörer verändern werde. Gern hätte er etwas Positiveres berichtet.
Im Verlauf der Diskussion konnten die Oberstufenschüler ihre gut vorbereiteten Fragen an die Expertenrunde richten, offen gebliebene Fragen konnten dann in kleineren Gesprächskreisen am Ende der Veranstaltung gestellt werden (siehe Fotos). Hier war es möglich bestehende Wissenlücken zu den beiden anderen Weltreligionen neben dem Islam zu schließen. Für manche SchülerInnen war es denn dann gar an diesem Nachmittag die erste Begegnung mit einem Menschen jüdischen Glaubens überhaupt!